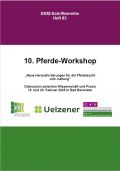Stellungnahmen
Die Liste der einheimischen und bodenständigen Nutzgeflügelrassen in Deutschland wurde vom Arbeitskreis Kleintiere im Fachbeirat Tiergenetische Ressourcen überarbeitet. Dabei wurden die Besonderheiten der Rassenentwicklung und Farbenschläge stärker berücksichtigt.
In der Stellungnahme wird auf die drohenden negativen Auswirkungen der Änderungen auf die biologische Vielfalt der einheimischen landwirtschaftlichen Kleintiere eingegangen.
Zur Kurzstellungnahme:
Ziel dieser Stellungnahme ist es, in der öffentlichen Verwaltung und in den Verbänden auf die Vielfalt der einheimischen Nutztierrassen und deren Gefährdung sowie Fähigkeiten in der Landschaftspflege und dem Vertragsnaturschutz aufmerksam zu machen. Hierdurch bietet sich eine gute Gelegenheit der Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft mit beiderseitigem Nutzen.
Zur Stellungnahme:
In der Stellungnahme wird auf die drohenden negativen Auswirkungen der Änderungen auf die biologische Vielfalt der einheimischen Nutztierrassen eingegangen.
Am 24. Mai 2024 hat das Bundeskabinett den Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes beschlossen. In Teilen können die geplanten gesetzlichen Änderungen nach Einschätzung des Fachbeirates Tiergenetische Ressourcen massive negative Auswirkungen auf vom Aussterben bedrohte einheimische Nutztierrassen und damit auf die biologische Vielfalt hervorrufen. Die Erhaltung einheimischer Nutztierrassen in Reinzucht und damit deren genetischer Vielfalt wird auch von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) als Grundlage angesehen, um auf zukünftige Herausforderungen wie z. B. den Klimawandel, die Umstellung auf andere Produktionssysteme oder sich ändernde Verbrauchergewohnheiten reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund sieht der Fachbeirat Tiergenetische Ressourcen akuten Handlungsbedarf, um auf nachfolgende Punkte im neuen Gesetzesentwurf hinzuweisen, durch die eine signifikante
Reduktion der biologischen Vielfalt induziert wird.
Zur Stellungnahme:
Die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland und die damit einhergehende Wiederbesiedelung der Lebensräume ist aus Sicht des Artenschutzes als ein Erfolg zu begrüßen. Mit dem Wolf kehren andererseits aber auch Probleme zurück, von denen besonders die Weidetierhalterinnen und -halter betroffen sind. Der Fachbeirat Tiergenetische Ressourcen zeigt in seiner Stellungnahme Maßnahmen auf, die ein Nebeneinander von Wolf und Weidetierhaltung ermöglichen.
Zur Stellungnahme:
Ein Autorenteam des Genetisch Statistischen Ausschusses (GSA) der DGfZ hat sich unter der Leitung von Prof. Dr. Kay-Uwe Götz mit dem Inhalt und den Argumentationen des BTK-Diskussionspapier Leistungen der Milchkühe und deren Gesundheitsrisiken
der Arbeitsgruppe Tierschutz in der Nutztierzucht
kritisch auseinandergesetzt und äußert sich in seiner Stellungnahme insbesondere zu
- den Fehlinterpretationen von Abgangsursachen
- den Aussagen zu
wertlosen
Bullenkälbern - der falschen Einschätzung züchterischer Möglichkeiten und Grenzen
- dem Thema Genetik vs. Management
- den Rahmenbedingungen der Zucht
- und dem Vorwurf der
Qualzucht
Die Stellungnahme der DGfZ finden Sie hier:
Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Kritik an die landwirtschaftliche Tierhaltung hat die DGfZ ein Autorenteam unabhängiger Tierzuchtwissenschaftler gebeten, ihre Ansätze zu einer gesellschaftlich akzeptierten Tierzucht mit dem Ziel vorzustellen, den Prozess des Dialoges verschiedener Standpunkte lösungsorientiert und mit Zukunftsperspektive zu fördern. Die nachfolgenden Gedanken und Thesen stellen ausdrücklich die Einschätzungen des Autorenteams als Grundlage weiterer Diskussionen dar.
Für nahezu alle Merkmale der Gesundheit, der Fitness, der Robustheit und des Wohlergehens von Nutztieren gilt, dass sie überwiegend durch die jeweilige Umwelt bestimmt werden. Das Genom ist, wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße, an der Ausprägung bzw. Prädisposition der genannten Merkmalskomplexe beteiligt. Tierzüchterische Anstrengungen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlergehen sind sinnvoll und sogar besonders nachhaltig, weil tierzüchterische Verbesserungen der Gesundheit ganzer Populationen kumulativ wirken.
Dabei darf sich die Haltung und Züchtung von zur Erzeugung von Lebensmitteln gehaltenen Tieren nicht dem Diskurs in der Gesellschaft entziehen. Kontinuierlich sind Diskussionen darüber nötig, was die Gesellschaft für akzeptabel hält und was nicht. Alle Diskussionen sind aber auch in einen volks- und betriebswirtschaftlichen Kontext einzubetten, da weitere Anstrengungen auf dem Gebiet der Gesundheit und des Wohlergehens von Nutztieren nicht dazu führen sollten, die deutsche Landwirtschaft in einem globalen Wettbewerb mit offenen Märkten ins Abseits zu drängen.
Der Genetisch-Statistische Ausschuss der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) hat sich intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt und folgende Stellungnahme dazu publiziert:
Wie sieht unsere aktuelle Milchviehzucht und -haltung aus? Wo brauchen wir zukunftsweisende Veränderungen? Welche Vorteile und welche Nachteile entstehen bei unterschiedlichen Strategien? Viele Fragen auf die die DGfZ-Projektgruppe Zukunft gesunde Milchkuh
in ihrem Positionspapier antworten liefert.
Die Projektgruppe der Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde Zukunft gesunde Milchkuh
hat ihr Positionspapier Zukunftsfähige Konzepte für die Zucht und Haltung von Milchvieh im Sinne von Tierschutz, Ökologie und Ökonomie
veröffentlicht, an dem Landwirte, Wissenschaftler, Züchter und Tierärzte mitgewirkt haben. Das Papier zeigt Strategien für die Zucht, Haltung und Fütterung sowie das dazugehörige Management für eine zukunftsfähige Milchviehhaltung auf. Dabei wurden Möglichkeiten und Grenzen von Maßnahmen wissenschaftlich fundiert erörtert, denn nicht jeder Wunsch
der Gesellschaft ist unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen der Produktion umsetzbar. Bestehende Zielkonflikte haben darüber hinaus einen entscheidenden Einfluss darauf, welche betriebsindividuellen Entscheidungen der Landwirt treffen muss. Dies deutlich zu kommunizieren, ist ein Grundbaustein für die Akzeptanz der zukünftigen Milchviehhaltung in Deutschland.
Die Nutztierhaltung spielt zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie der Ernährungssicherung und des Klimawandels eine große Rolle. Die Leistung der Nutztiere, Wechselwirkungen zwischen Leistung und Tiergesundheit sowie die Nutzungsdauer der Tiere sorgen immer wieder für gesellschaftliche Diskussionen und leider auch viel zu oft für negative Schlagzeilen, die eine ganze Berufsgruppe diskreditieren und die Verbraucher verunsichern. Die derzeitige große Herausforderung für Wissenschaft, Praxis und Beratung besteht darin, die aktuellen Tierhaltungssysteme so weiterzuentwickeln, dass die Aspekte der Tiergesundheit, der Leistungsfähigkeit, der Ökologie, der Ökonomie und der in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen mit dem Ziel der gesellschaftlichen Akzeptanz bestmöglich in Einklang gebracht werden. Dabei müssen die Aspekte interdisziplinär betrachtet und bewertet werden.
Schwerpunkte des Positionspapieres:
Unterteilt sind die Maßnahmen auf die Gebiete
Zucht
- Zuchtwertschätzung (Warum neue Wege? Welche sind sinnvoll? Wo fehlt noch die Datenbasis?)
- Genomics (Vorteile für Zucht und Selektion, Grenzen)
- Aktuelle Entwicklungen
Fütterung
- Was kann und muss die Fütterung und Futterwirtschaft leisten?
- Emissionsminderung
- Klimawandel – Auswirkungen kompensieren
- Rationsgestaltung
- Besonderheiten in der Transitphase
Haltung und Management
- Was muss ein gutes Herden- / Gesundheitsmanagement leisten?
- Jungtieraufzucht
- Jungkuhmanagement
- Frühlaktation
- Benchmarking zur Fehlersuche nutzen – es gibt keinen Zufall
- Neue Betriebskonzepte erproben - Freiwillige Wartezeit verlängern
Zum Positionspapier als pdf:
In der Stellungnahme des Fachbeirats Tiergenetische Ressourcen zu Stand, Probleme und Handlungsbedarf bei Erhaltungszuchtprogrammen für einheimische vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass das vorrangige Ziel in Erhaltungszuchtprogrammen zwar darin besteht, die Rassen mit ihren ursprünglichen Eigenschaften zu erhalten aber auch Raum für Selektion bleiben muss. Die Verbesserung wirtschaftlich bedeutender Merkmale, verbunden mit der Haltung der Tiere unter ursprünglichen Nutzungsbedingungen, ist durchaus sinnvoll, um die Chancen der Nutzung einer Rasse zu verbessern und ihre wirtschaftliche Unterlegenheit ohne Selektion nicht noch größer werden zu lassen.
In den letzten Jahren sind immer mehr Einzelgeneffekte bei unseren landwirtschaftlichen Nutztieren bekannt geworden, die es ermöglichen, in nur wenigen Generationen auf die gewünschten Allele zu züchten. Hierzu gehören z.B. die Hornlosigkeit bei Rindern, die Stressresistenz bei Schweinen und der Zusammenhang zwischen der PrP-Genotypisierung und der Empfänglichkeit für Scrapie bei Schafen und Ziegen. Für die genannten Einzelgeneffekte stehen direkte Gentests zur Verfügung, die auch die Erkennung von Trägertieren der gewünschten bzw. unerwünschten Allele ermöglichen. In Erhaltungszuchtprogrammen muss die züchterische Berücksichtigung solcher Einzelgeneffekte sehr vorsichtig und mit Bedacht geplant werden, um die Erhaltung der Rasse in Bezug auf Inzucht und genetische Variabilität nicht zu gefährden.
In dieser Empfehlung sollen Hinweise für den Umgang mit Einzelgeneffekten in Erhaltungszuchtprogrammen gegeben werden.
Zur Stellungnahme:



 Kurzstellungnahme AKK Tierschutzgesetz hier Kleintiere
Kurzstellungnahme AKK Tierschutzgesetz hier Kleintiere