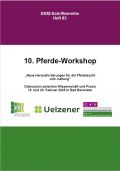DGfZ-Jahrestagung in Rostock: Erfolgreicher Austausch zur Künstlichen Intelligenz in der Nutztierhaltung
– Prominente Grußworte zum 120-jähringen Jubiläum der DGfZ –
Die gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ) und der Gesellschaft für Tierwissenschaften (GfT), die am 25. und 26. September 2025 an der Universität Rostock stattfand, überzeugte mit spannenden, hochaktuellen Inhalten. Eng eingebunden in die Vorbereitungen war auch das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie in Dummerstorf (FBN).
Unter dem zukunftsweisenden Thema Künstliche Intelligenz in der Nutztierhaltung
diskutierten führende Expertinnen und Experten aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen beim Einsatz digitaler Technologien in der Nutztierhaltung. Grußworte von Frau Prof. Dr. Nicole Wrage-Mönnig, (Prorektorin der Universität Rostock), Bundesminister Alois Rainer und Agrarminister Dr. Till Backhaus unterstrichen die gesellschaftliche und politische Relevanz der Veranstaltung.
In seiner Begrüßung erläuterte der Präsident der DGfZ, Herr Hans-Willi Warder, die lange Historie der DGfZ und betonte, dass ihr Auftrag bis heute unverändert geblieben sei. Trotz schwerer Zeiten hätten die Gründungsväter sowie bedeutende Persönlichkeiten der Gesellschaft stets an ihr festgehalten und sie um weitere Fachdisziplinen erweitert. Zunehmende Veränderungen in der Nutztierhaltung und -zucht hätten wiederholt gezeigt, wie wichtig eine sachgerechte Wissensvermittlung in der Branche ist. Dies werde auch durch die hohe Zahl der Teilnehmer in Rostock – fast 300 Personen – deutlich, so Warder.
Frau Prof. Dr. Nicole Wrage-Mönnig, Prorektorin für Forschung, Talententwicklung und Chancengleichheit der Universität Rostock, hieß die Teilnehmenden herzlich willkommen und betonte die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit: Zukunftsthemen lassen sich nur gemeinsam lösen – durch den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft.
Mit Blick auf die Innovationskraft der aktuellen Forschung wünschte sie allen Beteiligten eine erfolgreiche und inspirierende Tagung.
Digitale Videobotschaft von Bundesminister Alois Rainer
Ein besonderer Programmpunkt der Tagung war die digitale Videobotschaft des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer. Darin gratulierte er der DGfZ herzlich zum 120-jährigen Bestehen und würdigte ihre langjährige, engagierte Arbeit. Er dankte der DGfZ für die Übernahme zahlreicher Aufgaben, darunter die fachliche Begleitung im Rahmen des GSA, die Vertretung Deutschlands bei der EAAP/EVT sowie die Erstellung wichtiger Stellungnahmen.
Besonders hob der Minister die Unterstützung der DGfZ bei der Vorbereitung der EAAP-Jahrestagung 2026 hervor, die in Deutschland stattfinden wird. Er betonte die zentrale Rolle der Gesellschaft als fachlicher Impulsgeber und verlässlicher Partner der Politik und sprach ihr seinen ausdrücklichen Dank für die bereitgestellte Expertise aus.
Videobotschaft von Landesminister Dr. Till Backhaus
Neben dem Grußwort des Bundesministers sendete auch Dr. Till Backhaus, Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine digitale Videobotschaft. Darin äußerte er seine Sorge um die Zukunft der Tierhaltung in Deutschland angesichts wachsender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen. Er betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Nutztierstrategie auf den Weg gebracht habe – ein klares Signal für die Bedeutung nachhaltiger und zukunftsfähiger Tierhaltung.
Dr. Backhaus dankte der DGfZ für ihre engagierte Arbeit und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Tierzucht in Deutschland und Europa. Zum Jubiläum sprach er der Gesellschaft seine Anerkennung aus und wünschte ihr weitere 120 Jahre erfolgreicher Tätigkeit.
Plenarsitzung mit hochkarätigen Beiträgen
Künstliche Intelligenz in der Nutztierhaltung: Chancen, Herausforderungen und ethische Fragen
Im Rahmen der Plenartagung sprach Prof. Dr. Andreas Melfsen von der Fachhochschule Kiel über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Nutztierhaltung. Er zeigte auf, wie digitale Technologien – etwa zur Analyse des Fressverhaltens oder zur Bildauswertung – neue Möglichkeiten in der Tierbeobachtung eröffnen. Gleichzeitig wies er auf bestehende Herausforderungen hin, insbesondere hinsichtlich der Datenqualität und der sicheren Identifikation einzelner Tiere.
Ein zentrales Ziel der aktuellen Forschung ist die Übertragung von Verhaltensmustern in umfassende Prozessmodelle, um Haltungssysteme gezielt optimieren zu können. Dabei spielt auch die Verringerung des Aufwands für die manuelle Datenstandardisierung eine wichtige Rolle – ein Prozess, der bislang über 80 % der Analysezeit beansprucht.
Prof. Melfsen betonte zudem die Notwendigkeit erklärbarer KI, da mangelnde Transparenz das Vertrauen und die Akzeptanz bei Landwirten und Tierärzten untergräbt. Fehlende Erklärungen erschweren die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, was den praktischen Nutzen der Modelle einschränkt.
Die Analyse und Verbesserung von KI-Systemen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Hersteller ihre Algorithmen häufig als geistiges Eigentum schützen, was eine unabhängige wissenschaftliche Validierung behindert. Warnmeldungen ohne Kontext führen zu Alarmmüdigkeit, wodurch kritische Hinweise übersehen werden können.
Ein weiteres zentrales Thema war die Kompetenzlücke: Nutztierwissenschaftler verfügen in ihrer traditionellen Ausbildung oft nicht über das nötige Wissen in Mathematik, Statistik und Programmierung. Daher ist eine enge Zusammenarbeit mit KI-Experten unerlässlich – denen wiederum das biologische Fachwissen fehlt.
Dr. Dierck Segelke von der syniotec GmbH stellte die Potenziale generativer KI für Tierzucht und Tierhaltung vor und zeigte mit seinem Vortrag eindrucksvoll, wie KI-Technologien nicht nur Prozesse automatisieren, sondern auch die Qualität von Entscheidungen und Analysen deutlich verbessern können. Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie prägt bereits heute zahlreiche Lebens- und Arbeitsbereiche. Auch in der Tierzucht und Tierhaltung eröffnen sich durch den Einsatz generativer KI völlig neue Möglichkeiten. In seinem launigen Vortrag verdeutlichte er anschaulich die Probleme und Grenzen von KI, die bereits Schwierigkeiten hat ein komplett gefülltes Weinglas dazustellen.
Segelke erklärte, wie große Sprachmodelle funktionieren und wie man sie gezielt steuern kann – zum Beispiel durch die Auswahl einer Rolle (etwa Zuchtinspektor), einer Aufgabe und Hintergrundinformationen. So lassen sich präzisere Antworten erzeugen.
Neben den Vorteilen wie mehr Effizienz, genauere Analysen und bessere Vorhersagen sprach Dr. Segelke auch über Risiken: KI kann Fehler machen (halluzinieren
) und ist nicht immer zuverlässig.
Ein weiteres Thema war die Vernetzung von Daten für intelligente Systeme und der Vergleich verschiedener KI-Ansätze. Obwohl in der Tierzucht viele Daten vorhanden sind, müssen diese besser aufbereitet werden, damit KI sie sinnvoll nutzen kann.
Dr. Segelke rief dazu auf, sich jetzt aktiv mit KI zu beschäftigen. Die Technologie bietet große Chancen für die Zukunft der Tierzucht – doch es braucht konkrete Anwendungen mit echtem Mehrwert.
Dr. Sandra Düpjan vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie lieferte spannende Erkenntnisse, wie die Analyse von Tierlauten – insbesondere bei Schweinen – neue Wege für eine tiergerechtere Haltung eröffnen kann. Unter dem Titel Von sprechenden Schweinen und lauschenden KIs
stellte sie den potenziellen Nutzen bioakustischer Verfahren vor.
Schweine kommunizieren viel und vielfältig – ein Umstand, den die Bioakustik gezielt nutzen kann. Dr. Düpjan erläuterte, wie sich das Sender-Empfänger-Modell auf Schweine anwenden lässt und welche Faktoren – etwa Körpergröße oder emotionale Zustände – die Lautäußerungen beeinflussen. Ein kurzer Exkurs zur Lauterzeugung beim Schwein verdeutlichte die biologischen Grundlagen.
Ein Projekt ist zum Beispiel STREMODO, ein System zur automatischen Erkennung von Stressschreien – sowohl in der Haltung als auch beim Transport und am Schlachthof. Die Weiterentwicklung zielt darauf ab, nicht nur Stress zu erkennen, sondern auch differenzierte emotionale Zustände wie positive oder negative Affekte zu erfassen.
Dr. Düpjan sprach auch über die Herausforderungen der Bioakustik: Die zuverlässige Erkennung einzelner Laute, die korrekte Interpretation und die Klassifikation trotz hoher Variabilität – sowohl bei den Lauten selbst als auch durch Umgebungsgeräusche – sind komplexe Aufgaben, die noch intensiver Forschung bedürfen.
Ihr Fazit: Die Kombination aus Bioakustik und Künstlicher Intelligenz bietet großes Potenzial für die Verbesserung des Tierwohls. Schweine reden
– man muss ihnen nur richtig zuhören.
Im Anschluss an die spannenden Vorträge entwickelte sich eine lebhafte Diskussion mit dem Auditorium.
Die Referentinnen und Referenten standen den Teilnehmenden engagiert Rede und Antwort.

v.l.n.r. Moderator Prof. Klaus Wimmers, Dr. Dierck Segelke, Prof. Andreas Melfsen, Dr. Sandra Düpjan

v.l.n.r. Prof. Klaus Wimmers, Dr. Dierck Segelke, Prof. Andreas Melfsen, Dr. Sandra Düpjan

Engagierte Diskussion


Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung des DGfZ-Preises an herausragende Nachwuchswissenschaftler.
Zudem wurden Prof. Dr. Georg Thaller mit der Hermann-von-Nathusius-Medaille sowie Dr. Ludwig Christmann mit der Adolf-Köppe-Nadel ausgezeichnet.
In den folgenden vier parallelen Fachforen stellten rund 90 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ihre aktuellen Forschungsergebnisse aus den Bereichen Tierhaltung, Tierzucht, Tierwohl, Genomik und tiergenetische Ressourcen vor. Die rege Beteiligung und die lebhaften Diskussionen unterstrichen die hohe Relevanz und das Engagement der wissenschaftlichen Community.
Die Abendveranstaltung bot Gelegenheit zum Netzwerken und zum fachlichen Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Industrie. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam über die Zukunft einer nachhaltigen und technologisch unterstützten Nutztierhaltung zu diskutieren.
Die diesjährige Tagung hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig der interdisziplinäre Austausch für die Weiterentwicklung der Tierwissenschaften ist
, sagte Hans-Willi Warder, Präsident der DGfZ. Künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen – und wir stehen erst am Anfang.
Die DGfZ und die GfT organisierten die gemeinsame Jahrestagung 2025 in enger Kooperation mi dem Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN) sowie der Professur für Tierzucht und Haustiergenetik der Universität Rostock.
Die DGfZ feierte im Rahmen der Tagung ihr 120-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung wurde mit zehn ATF-Fortbildungsstunden zertifiziert.