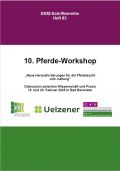Presse
Am 1. September 2014 wurde eine neue Kooperation in der europäischen Holstein Zucht gegründet.
Die Partner sind die skandinavischen VikingGenetics und die NOG (Nord Ost Genetic GmbH) mit den vier deutschen Unternehmen Rinderzucht Schleswig-Holstein eG (RSH), Rinderproduktion Berlin Brandenburg GmbH (RBB), RinderAllianz GmbH (RA) und Masterrind GmbH (MAR).
Quelle: RSHeG
Prof. Dr. Hermann Swalve, Professor für Tierzucht und Direktor des Instituts für Agrar- und Ernährungswissenschaften an der Naturwissenschaftlichen Fakultät III der MLU Halle-Wittenberg, wurde auf der 10. Weltkonferenz für angewandte Genetik bei landwirtschaftlichen Nutztieren zum Präsidenten des Permanent Committee gewählt. Die Weltkonferenz (World Congress on Genetics Applied to Livestock Production) ist die mit Abstand bedeutendste Tagung für Tiergenetiker landwirtschaftlicher Nutztiere und findet aufgrund der methodischen Parallelen mittlerweile auch Zuspruch bei Wissenschaftlern aus den Bereichen der Pflanzengenetik und anderer Fachrichtungen der Genetik. Die Bedeutung des Kongresses ergibt sich auch daraus, dass er lediglich in einem vierjährigen Turnus stattfindet. In diesem Jahr wurde der Kongress vom 17. bis 22. August in Vancouver, Kanada, veranstaltet und von 1600 Wissenschaftlern aus aller Welt besucht. Inhalte des Kongresses waren vornehmlich Studien an Nutztieren auf der Basis von Hochdurchsatz-Array-Genotypisierungen sowie von Daten aus der Sequenzierung ganzer Genome. Hinsichtlich der bei Nutztieren durch die Zucht zu verbessernden Eigenschaften standen insbesondere die Bereiche Krankheitsresistenz und Futtereffizienz im Vordergrund. Die Arbeitsgruppe von Prof. Swalve war mit gleich zwei eingeladenen Hauptvorträgen zu den Themen Nutzen der Hochdurchsatztypisierung in kleinen Populationen
(Frau Dr. Schöpke) und Die Bedeutung einzelner funktionaler Mutationen beim Milchrind
(Prof. Swalve) am Programm beteiligt. Als Präsident des Permanent Committee obliegt Prof. Swalve die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den lokalen Veranstaltern der kommenden Tagung (Februar 2018 in Auckland, Neuseeland) für die kontinuierliche Weiterentwicklung des gesamten Kongresses in Aufbau und Struktur zu sorgen, Vorschläge zum wissenschaftlichen Programm zu machen, sowie Repräsentationspflichten zu übernehmen.
Quelle: Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Strategie zur Europäischen Forschung
Mit einem Anteil von nahezu 30 Prozent an der weltweiten Wissensproduktion ist Europa grundsätzlich gut aufgestellt, um als ein Kontinent der Ideen seine Zukunftsfähigkeit zu sichern und eine führende Position in Wissenschaft, Forschung und Technologie zu behaupten, heißt es in der als Unterrichtung vorliegenden Strategie der Bundesregierung zum Europäischen Forschungsraum (18/2260). Die Bundesregierung weist daraufhin, dass Deutschland dazu als größte Forschungsnation Europas einen wesentlichen Beitrag leistet. Gleichwohl verschärfe sich der globale Wissens- und Innovationswettbewerb zunehmend: So würden bedeutende wissenschaftlich-technologische Zentren und Innovationskapazitäten vor allem in Asien mit großer Dynamik weiter ausgebaut. Die Forschungsausgaben würden in dieser Weltregion (2012: 561 Milliarden US-Dollar; 2014: 632 Milliarden US-Dollar) nach aktuellen Schätzungen sehr viel schneller als in Europa (2012: 350 Milliarden US-Dollar; 2014: 351 Milliarden US-Dollar) wachsen. Neben stärkerer Konkurrenz würden sich aber aus dieser Entwicklung auch neue Kooperationschancen ergeben, die es im gegenseitigen Interesse zu nutzen gelte, heißt es in der Unterrichtung.
Quelle: Dt. Bundestag
Mehrere berufsständige Organisationen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben heute in Münster das Forum für Tiergesundheit und Tierwohl (FTT) in der Schweinehaltung gegründet. Vorrangige Aufgabe des Forums wird sein, die Zusammenarbeit aller Fachleute aus dem Bereich der Schweinehaltung zu optimieren und Lösungsansätze für aktuelle Fragen rund um die Themen Tiergesundheit und Tierwohl zu entwickeln.
Lesen Sie die ganze Meldung HIER.
Quelle: Topagrar.com
Schleswig-Holstein: Agrarminister Habeck beruft Vertrauensmann Tierschutz in der Landwirtschaft
Schleswig-Holsteins Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck hat erstmals einen Vertrauensmann für den Tierschutz
in der Landwirtschaft berufen. Die Aufgabe übernimmt Prof. Dr. Dr. Edgar Schallenberger, Emeritus am Institut für Tierzucht und Tierhaltung - Abteilung Tierhygiene und ökologische Tierhaltung - der CAU Kiel.
Prof. Schallenberger soll als Vertrauensmann Landwirten, Tierzüchtern, Veterinären – kurz Mitarbeitern aus der gesamten Produktionskette – sowie Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner für Angelegenheiten des Tierschutzes in der Nutztierhaltung zur Verfügung stehen. Er soll sie mit Rat und Tat in Fragen des Tierschutzes unterstützen, den Minister und mich beraten und gegebenenfalls zwischen den Beteiligten vor Ort vermitteln
, so das Ministerium.
Prof. Schallenberger erklärte: Ich möchte nach allen Seiten offen sein für Sorgen, Nöte und Kritik. Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung als Veterinär und Landwirt möchte ich Zuhörer und Ratgeber sein und helfen, auch mal überraschende und neue Lösungswege zu finden.
Seine Kontaktdaten sind:
Telefonnummern: 0431-880 4531 und 0160-551 8777;
Email: eschallenberger@tierzucht.uni-kiel.de.
Quelle: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume / DGfZ
Erster Lagebericht der BMEL-Arbeitsgruppe – Schmidt: Bei erkennbaren Schieflagen werden wir Krisenmaßnahmen einleiten
Die Auswirkungen des russischen Importstopps für Agrarprodukte werden nach einer ersten Einschätzung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für die deutschen Erzeuger spürbar sein, aber beherrschbar bleiben. Dazu erklärt Bundesagrarminister Christian Schmidt: Dieses politisch motivierte Embargo richtet sich gegen eine Vielzahl von Ernährungsgütern, die bisher erfolgreich nach Russland exportiert wurden. Wir werden sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene die Märkte sehr genau beobachten und analysieren. Es ist gut, dass die betroffenen Branchen sich dieser schwierigen Marktsituation entgegenstemmen und neue Absatzmärkte ausloten. Dabei werde ich sie tatkräftig unterstützen. Bei erkennbaren deutlichen Schieflagen des Marktes für einzelne Produktgruppen werden wir auf europäischer Ebene entsprechende Krisenmaßnahmen beraten und einleiten
, sagte Schmidt. Die Vernichtung von Lebensmitteln sei in diesem Zusammenhang für ihn kein Weg für eine adäquate Marktstützung. Vorrang hat die Förderung des Absatzes. Dabei wird für die Agrarmärkte auch die gesamtpolitische Lage und die weitere Entwicklung der russischen Position zur Krise in der Ukraine eine Rolle spielen. Diese Pflicht zur Eindämmung der Kriegsgefahr werden wir nicht aus den Augen verlieren, auch im Hinblick auf die Entscheidungen der EU zu Sanktionen.
Quelle: BMEL
Die IFN Schönow GmbH bietet dieses Jahr erstmals den von der ADR empfohlenen Ergänzungslehrgang für Besamungsbeauftragte der Tierart Rind an. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, nach erfolgreich abgelegter Prüfung nach der Verordnung über Lehrgänge nach dem Tierzuchtgesetz ihr Wissen in den Bereichen Ovardiagnostik, Trächtigkeitsuntersuchung, Fruchtbarkeitsmanagement und Kommunikation zu vertiefen. Dazu werden drei Module von je einer Woche angeboten, in denen in praktischen Übungen ergänzt durch praxisbezogenes theoretisches Wissen in kleinen Gruppen die verschiedenen Themen erarbeitet werden. Das erste Modul (Ovardiagnostik/Kommunikation) findet vom 10.11. – 14.11.2014 statt, das zweite (Trächtigkeitsuntersuchung/Kommunikation) vom 08.12. – 12.12.2014 und das dritte (Fruchtbarkeitsmanagement/Kommunikation und Abschlussprüfung) vom 09.02. – 13.02.2015. Darüber hinaus stehen für jedes Modul alternative Wahltermine zur Verfügung. Die Teilnahme wird nach bestandener Prüfung durch die Ausbildungsstätte zertifiziert und ist ausschließlich Personen vorbehalten, die bei einer der ADR angeschlossenen Organisationen beschäftigt sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten betragen 1.500 € (netto) zzgl. Verpflegungs- und Übernachtungskosten. Mehr unter lehrgang@ifn-schoenow-gmbh.de (Tel.: 03338 70 98 19) oder auch www.adr-web.de.
Informationen des IFN Schönow GmbH finden Sie hier: 2014 Info Modulreihe Ergänzungslehrgang Für Besamungsbeaufragte
Quelle: IFN/ADR
Die ADR-Rinderproduktion in Deutschland Ausgabe 2013
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter ist erschienen und kann über die Geschäftsstelle für 15 € zzgl. Versandkosten und MwSt. bestellt werden. Darüber hinaus stehen die Tabellen zum Download unter www.adr-web.de im Mitgliederbereich zur Verfügung. Bestellformulare sind ebenfalls unter dieser Adresse zu finden. Bestellungen sind auch über info@adt.de möglich.
Quelle: ADR
Die Agrar- und Ernährungsbranche muss ihre Opferrolle in der Kommunikation verlassen! Der Beratungsbereich Communications & PR von Agrifood Consulting in Berlin definiert mit einer eigenen Trendstudie den Professionalisierungsbedarf der Agrar- und Ernährungsbranche im Bereich Kommunikation. Die Trendstudie können Sie bei Interesse von der Internetseite "agrifood.kompakt" herunterladen.
Quelle: DGfZ/ZDS
Neue Regelungen für die gewerbsmäßige Haltung von Kaninchen treten am 11. August in Kraft
- Mehr Tierschutz für Kaninchen -
Ab dem 11. August 2014 gelten neue Regelungen für die Haltung von Mast- und Zuchtkaninchen. Die neuen Regelungen sehen strenge Anforderungen an die Haltung, Betreuung und Pflege von Kaninchen vor, die zu Erwerbszwecken gehalten werden. Das betrifft beispielsweise die Mindestgröße, die Bodengestaltung und die Strukturierung der Haltungseinrichtungen. So muss den Tieren eine strukturierte Fläche mit unterschiedlichen Funktionsbereichen (Aktivitätsbereich, Ruhebereich, Rückzugsmöglichkeit) angeboten werden, die für kaninchentypische Verhaltensweisen (z.B. Hoppelsprünge, Sich-Aufrichten, ausgestrecktes Liegen in Seitenlage) genutzt werden kann. Stärker in die Pflicht genommen werden außerdem die Tierhalter. Die neue Kaninchen-Verordnung gibt unter anderem vor, dass der Halter seine Tiere mindestens zwei Mal pro Tag in Augenschein nehmen muss, um festzustellen, ob sie krank oder verletzt sind. Zudem müssen Kaninchenhalter ihre Sachkunde im Umgang mit Kaninchen nachweisen. Damit haben wir erstmals überhaupt detaillierte Anforderungen und klare Regelungen für die Haltung von Kaninchen zu Erwerbszwecken
, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Berlin. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Tierschutz in der Nutztierhaltung
, so der Minister weiter.
Quelle: BMEL