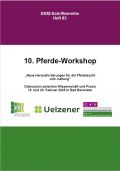Presse
Eine Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen beschäftigte sich in Zusammenarbeit mit der LSZ Boxberg mit der Klauengesundheit von Wartesauen in zwei verschiedenen Gruppenhaltungsverfahren. Hierzu wurden Klauenbonituren auf 20 Ferkelerzeugerbetrieben in Baden-Württemberg durchgeführt. Insgesamt wurden die Klauen von 2.582 Tieren bonitiert. Folgende Parameter wurden mit den Noten 1 (keine Auffälligkeiten) bis 4 (extreme Veränderung) bewertet.
Lesen Sie hier den Originalartikel:
Ergebnisse aus der Jungebermast der TLL Jena
Dr. Simone Müller von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Jena informiert in der Unternehmenszeitschrift Schweinezucht aktuell
(Ausgabe 38/2011) über das Ergebnis eines Fütterungsversuches mit Mastschweinen aus der Anpaarung der MSZV-Hybridsau mit der Piétrain-Vaterrasse. Eingestallt wurden Sau- und Eberferkel sowie Börge. Bei der Einschätzung des Handelswertes erhielten die Jungmasteber aufgrund des hohen Fleischanteils im Bauch einen Zuschlag von 5 Cent je kg Schlachtgewicht. Allerdings lag die Schlachtausbeute nur bei 78,6 % (Sauen 80,5 %, Börge 79,6 %). Aufgrund der hohen Tageszunahme der männlichen Ferkel (rd. 970 Gramm unter Prüfstallbedingungen) konnte die Mast bereits eine Woche vor den anderen Prüftieren beendet werden.
Hier lesen Sie den Originalartikel,
Der belgische Berufsverband der Schlachter und Fleischverarbeiter (FEBEV) hat in einer Pressemeldung mitgeteilt, dass die FEBEV und ihre Mitglieder ab dem 01.01.2012 keine kastrierten Schweine ohne Betäubung mehr tolerieren.
Epigenetische Veränderungen sind umkehrbar
Erste umfassende Kartierung von epigenetischen Veränderungen über mehrere Generation zeigt, dass diese oft kurzlebig sind und daher wahrscheinlich nur selten die Evolution beeinflussen.
Die Gruppenhaltung tragender Sauen muss ab dem 01.01.2013 in allen sauenhaltenden Betrieben in Deutschland und der Europäischen Union gewährleistet sein. Auch Betriebe in Baden-Württemberg befinden sich noch im Umstellungsprozess, um die Anforderungen umsetzen zu können. Mit dieser Artikelserie will die LSZ Boxberg den sauenhaltenden Betrieben aktuelle und wichtige Informationen rund um das Thema Gruppenhaltung tragender Sauen vermitteln. Darüber hinaus soll an praktischen Betriebsbeispielen aufgezeigt werden, wie die oben genannten Anforderungen in den Betrieben umgesetzt werden können. Dabei werden die betrieblichen Voraussetzungen und sonstige Überlegungen der Betriebsleiter genau so betrachtet wie die Investitionskosten und Erfahrungen, welche die Betriebsleiter mit dem jeweiligen Haltungssystem bereits gesammelt haben.
Eine ausreichende Phosphorversorgung ist wichtig für vielfältige Körperfunktionen und Stoffwechselprozesse. Extremer Phosphormangel in der Fütterung führt zu Knochenerkrankungen und Wachstumsstörungen bei Jungtieren, kommt aber selten vor. Häufig vermutete unmittelbare Zusammenhänge zwischen der Phosphorversorgung und der Fruchtbarkeit bestehen nicht. Als Folge von anhaltendem Phosphormangel kann allerdings reduzierter Futterverzehr mit der Beeinträchtigung der Mikrobentätigkeit, der Faserverdauung und der Proteinsynthese im Pansen auftreten. Bei Milchkühen würden daraus Einbußen bei der Milch- und Eiweißleistung und möglicherweise Fruchtbarkeitsprobleme resultieren. Um solche Negativeffekte auszuschließen, muss die Versorgung in allen Laktationsphasen bedarfsdeckend sein.
Forscher des Leibnitz-Institutes für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf haben nach eigenen Angaben erstmals eine Genvariante bei Säugetieren identifiziert, die für stärkeres Wachstum vor und nach der Geburt verantwortlich ist.
Schaumann-Preis an Herrn Prof. Drögemöller
Die H. Wilhelm Schaumann Stiftung verleiht im zweijährigen Turnus Förderpreise an junge Wissenschaftler für herausragende Leistungen. Ein mit 10.000 Euro dotierter Förderpreis für das Jahr 2011 wurde am 06. September 2011 im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaften und der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde an Herrn Professor Dr. Cord Drögemüller, Bern, verliehen.
Schaumann-Preis an Herrn Prof. Zebeli
Die H. Wilhelm Schaumann Stiftung verleiht im zweijährigen Turnus Förderpreise an junge Wissenschaftler für herausragende Leistungen. Ein mit 10.000 Euro dotierter Förderpreis für das Jahr 2011 wurde im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für Tierzuchtwissenschaften und der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde am 06. September 2011 an Herrn Professor Dr. Quendrim Zebeli, Wien, verliehen.
Reiten in der Schule
Welche pädagogischen Potenziale birgt der Reitsport? In welcher Form eignet sich Reiten für den Sportunterricht an Schulen? Mit diesen Fragen befasst sich Katharina Lipfert in ihrer Doktorarbeit am Institut für Sportwissenschaft der Universität Würzburg.